We will keep fighting for all libraries - stand with us!

Internet Archive Audio

- This Just In
- Grateful Dead
- Old Time Radio
- 78 RPMs and Cylinder Recordings
- Audio Books & Poetry
- Computers, Technology and Science
- Music, Arts & Culture
- News & Public Affairs
- Spirituality & Religion
- Radio News Archive

- Flickr Commons
- Occupy Wall Street Flickr
- NASA Images
- Solar System Collection
- Ames Research Center

- All Software
- Old School Emulation
- MS-DOS Games
- Historical Software
- Classic PC Games
- Software Library
- Kodi Archive and Support File
- Vintage Software
- CD-ROM Software
- CD-ROM Software Library
- Software Sites
- Tucows Software Library
- Shareware CD-ROMs
- Software Capsules Compilation
- CD-ROM Images
- ZX Spectrum
- DOOM Level CD

- Smithsonian Libraries
- FEDLINK (US)
- Lincoln Collection
- American Libraries
- Canadian Libraries
- Universal Library
- Project Gutenberg
- Children's Library
- Biodiversity Heritage Library
- Books by Language
- Additional Collections

- Prelinger Archives
- Democracy Now!
- Occupy Wall Street
- TV NSA Clip Library
- Animation & Cartoons
- Arts & Music
- Computers & Technology
- Cultural & Academic Films
- Ephemeral Films
- Sports Videos
- Videogame Videos
- Youth Media
Search the history of over 866 billion web pages on the Internet.
Mobile Apps
- Wayback Machine (iOS)
- Wayback Machine (Android)
Browser Extensions
Archive-it subscription.
- Explore the Collections
- Build Collections
Save Page Now
Capture a web page as it appears now for use as a trusted citation in the future.
Please enter a valid web address
- Donate Donate icon An illustration of a heart shape
Powers of horror : an essay on abjection
Bookreader item preview, share or embed this item, flag this item for.
- Graphic Violence
- Explicit Sexual Content
- Hate Speech
- Misinformation/Disinformation
- Marketing/Phishing/Advertising
- Misleading/Inaccurate/Missing Metadata
![[WorldCat (this item)] [WorldCat (this item)]](https://archive.org/images/worldcat-small.png)
plus-circle Add Review comment Reviews
2,508 Previews
119 Favorites
DOWNLOAD OPTIONS
No suitable files to display here.
EPUB and PDF access not available for this item.
IN COLLECTIONS
Uploaded by DeannaFlegal on April 21, 2009
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
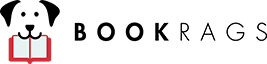
- study guides
- lesson plans
- homework help
Powers of Horror: An Essay on Abjection Summary & Study Guide
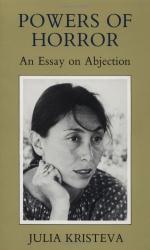
Powers of Horror: An Essay on Abjection Summary & Study Guide Description
Kristeva examines the notion of abjection—the repressed and literally unspeakable forces that linger inside a person's psyche—and traces the role the abject has played in the progression of history, especially in religion. She turns to the work of Louis-Ferdinand Celine as an almost ideal example of the cathartic, artistic expression of the abject.
Kristeva begins with what she calls a "phenomenological" investigation of the abject. This means that Kristeva uses her personal experience—and the expressed experiences of others—to get some idea of what the abject is. From that basis, she goes onto give it a more rigorous definition. The abject, in short, is a kind of non-object that lingers in a person's psyche, the consequence of repression. In order to understand why the abject is not an object, one must under the post-modernist theory of language that Kristeva subscribes to. Kristeva believes that the entire world, including one's self, is understood through language; it is the only lens, so to speak, by which we can understand anything. Now, one is not born speaking; rather, language is a gradual development during the course of one's childhood. Simultaneous with this linguistic development are several crises which Kristeva borrows largely from the psychoanalytic work of Sigmund Freud. Most important of these crises is the Oedipus complex, in which the child begins to lust for his mother but is unable to have her because of his father. Ultimately, he resigns himself to the fact that he will never have his mother and represses the desire for her. As this complex is largely pre-linguistic—or, at least, before linguistic abilities have fully developed—the lingering, repressed remnants of this lust continue to linger in the soul but they never gain the "substance" of expression.
Kristeva argues that the abject exerts a tremendous psychological impact on individuals and, indeed, on societies as a whole. Religion is a natural response to the abject, for if one truly experiences the abject, he is prone to engage in all manners of perverse and anti-social behaviors. Therefore, religion creates a buffer between one's mind and the abject and further represses them. Kristeva follows Freud in her belief that repressed desires tend to manifest themselves unconsciously and symbolically. This can happen occasionally in something like the slip of the tongue—the so-called "Freudian slip"—but it also happens in art. Indeed, art is indispensable to investigating the abject, because its non-linguistic nature prevents it from ever being directly expressed. Kristeva traces the influence of the abject, particularly the abject as related to mother-lust, in the development of Judaism and Christianity. She sees the strict Mosaic laws as reducing, fundamentally, to the incest taboo, the most basic (and obvious) response to one's repressed mother-lust. Christianity builds upon (but also contradicts) Judaism by identifying the abject almost directly—with the new, Christian concept of sin as something inside of oneself—but then strictly forbidding it. In the Christian world, one becomes more divided than ever.
The only refuge one has against the repression of religion and political bodies is art, and Kristeva finds Celine to be an abject author par excellence. His work is, intentionally, revolting. He describes in graphic detail the crudest and most vile aspects of human life in order to force the reader to consider those parts of his existence which he tries to escape, much like he tries to escape the horror of the abject. He perverts the traditional Oedipal triangle—child, mother, and father as one who desires, one who is desired, and an obstacle or law, respectively—by turning the mother either into something hateful and undesirable, by turning the child into the father (in a perverted episode of incest), or turning the mother into the father. All of Celine's work is focused on revealing the abject to the reader, not by describing the abject directly, but by destroying the structures with which the reader protects himself from it—his own psychology and language.
Kristeva concludes her essay by noting that the usefulness of studying the abject can be found in its immense political and religious influence over the centuries. The institutions which wield power in the modern world, which she believes to be oppressive and inhumane, are built upon the notion that man must be protected from the abject. By facing the abject face-to-face one tears away the support of these institutions and embarks on the first movement that can truly undermine them.
Read more from the Study Guide

FOLLOW BOOKRAGS:

Site Content
Powers of horror.
An Essay on Abjection
Julia Kristeva. Translated by Leon S. Roudiez
Columbia University Press
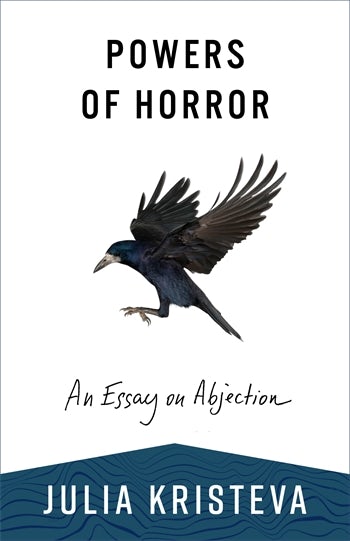
Pub Date: February 2024
ISBN: 9780231214575
Format: Paperback
List Price: $24.00 £20.00
Shipping Options
Purchasing options are not available in this country.
Pub Date: March 2024
ISBN: 9780231561419
Format: E-book
List Price: $23.99 £20.00
- EPUB via the Columbia UP App
- PDF via the Columbia UP App
Dazzling. SubStance
Julia Kristeva’s Powers of Horror , which theorizes the notion of the ‘abject’ in a series of blisteringly insightful analyses, is as relevant, as necessary, and as courageous today as it seemed in 1984. Peter Connor, Barnard College
Critics who seek an alternative to sexist and, in general, imperialist practices in psychoanalytic writing will want to read [this book]. Discourse
Follow the author

Image Unavailable

- To view this video, download Flash Player
Powers of Horror: An Essay on Abjection Paperback – Feb. 13 2024
Purchase options and add-ons.
- Part of series European Perspectives: A Series in Social Thought and Cultural Criticism
- Print length 248 pages
- Language English
- Publisher Columbia University Press
- Publication date Feb. 13 2024
- Dimensions 13.97 x 1.91 x 21.59 cm
- ISBN-10 023121457X
- ISBN-13 978-0231214575
- See all details
Frequently bought together

Popular titles by this author

Product description
About the author, product details.
- Publisher : Columbia University Press; Reissue edition (Feb. 13 2024)
- Language : English
- Paperback : 248 pages
- ISBN-10 : 023121457X
- ISBN-13 : 978-0231214575
- Item weight : 322 g
- Dimensions : 13.97 x 1.91 x 21.59 cm
- #7 in Hispanic American Literary Criticism
- #426 in Psychoanalysis (Books)
About the author
Julia kristeva.
Discover more of the author’s books, see similar authors, read author blogs and more
Customer reviews
Reviews with images.

- Sort reviews by Top reviews Most recent Top reviews
Top reviews from Canada
There was a problem filtering reviews right now. please try again later..
Top reviews from other countries
- Amazon and Our Planet
- Investor Relations
- Press Releases
- Amazon Science
- Sell on Amazon
- Supply to Amazon
- Become an Affiliate
- Protect & Build Your Brand
- Sell on Amazon Handmade
- Advertise Your Products
- Independently Publish with Us
- Host an Amazon Hub
- Amazon.ca Rewards Mastercard
- Shop with Points
- Reload Your Balance
- Amazon Currency Converter
- Amazon Cash
- Shipping Rates & Policies
- Amazon Prime
- Returns Are Easy
- Manage your Content and Devices
- Recalls and Product Safety Alerts
- Customer Service
- Conditions of Use
- Privacy Notice
- Interest-Based Ads
- Amazon.com.ca ULC | 40 King Street W 47th Floor, Toronto, Ontario, Canada, M5H 3Y2 |1-877-586-3230

- Kindle Store
- Kindle eBooks
- Health, Fitness & Dieting
Promotions apply when you purchase
These promotions will be applied to this item:
Some promotions may be combined; others are not eligible to be combined with other offers. For details, please see the Terms & Conditions associated with these promotions.
Buy for others
Buying and sending ebooks to others.
- Select quantity
- Buy and send eBooks
- Recipients can read on any device
These ebooks can only be redeemed by recipients in the US. Redemption links and eBooks cannot be resold.

Download the free Kindle app and start reading Kindle books instantly on your smartphone, tablet, or computer - no Kindle device required .
Read instantly on your browser with Kindle for Web.
Using your mobile phone camera - scan the code below and download the Kindle app.

Follow the author

Image Unavailable

- To view this video download Flash Player

Powers of Horror: An Essay on Abjection (European Perspectives: A Series in Social Thought and Cultural Criticism) Kindle Edition
- Part of series European Perspectives: A Series in Social Thought and Cultural Criticism
- Print length 234 pages
- Language English
- Sticky notes On Kindle Scribe
- Publisher Columbia University Press
- Publication date March 26, 2024
- File size 1316 KB
- Page Flip Enabled
- Word Wise Enabled
- Enhanced typesetting Enabled
- See all details
- In This Series
- By Julia Kristeva

Editorial Reviews
From the back cover, about the author, product details.
- ASIN : B0CQRWR73L
- Publisher : Columbia University Press (March 26, 2024)
- Publication date : March 26, 2024
- Language : English
- File size : 1316 KB
- Text-to-Speech : Enabled
- Screen Reader : Supported
- Enhanced typesetting : Enabled
- X-Ray : Not Enabled
- Word Wise : Enabled
- Sticky notes : On Kindle Scribe
- Print length : 234 pages
- Page numbers source ISBN : 0231053479
- #54 in Psychoanalysis
- #163 in Medical Psychoanalysis
- #253 in Popular Psychology Psychoanalysis
About the author
Julia kristeva.
Discover more of the author’s books, see similar authors, read author blogs and more
Customer reviews
Customer Reviews, including Product Star Ratings help customers to learn more about the product and decide whether it is the right product for them.
To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyzed reviews to verify trustworthiness.
Reviews with images

- Sort reviews by Top reviews Most recent Top reviews
Top reviews from the United States
There was a problem filtering reviews right now. please try again later..
Top reviews from other countries
Report an issue
- Amazon Newsletter
- About Amazon
- Accessibility
- Sustainability
- Press Center
- Investor Relations
- Amazon Devices
- Amazon Science
- Sell on Amazon
- Sell apps on Amazon
- Supply to Amazon
- Protect & Build Your Brand
- Become an Affiliate
- Become a Delivery Driver
- Start a Package Delivery Business
- Advertise Your Products
- Self-Publish with Us
- Become an Amazon Hub Partner
- › See More Ways to Make Money
- Amazon Visa
- Amazon Store Card
- Amazon Secured Card
- Amazon Business Card
- Shop with Points
- Credit Card Marketplace
- Reload Your Balance
- Amazon Currency Converter
- Your Account
- Your Orders
- Shipping Rates & Policies
- Amazon Prime
- Returns & Replacements
- Manage Your Content and Devices
- Recalls and Product Safety Alerts
- Conditions of Use
- Privacy Notice
- Consumer Health Data Privacy Disclosure
- Your Ads Privacy Choices
- Architecture and Design
- Asian and Pacific Studies
- Business and Economics
- Classical and Ancient Near Eastern Studies
- Computer Sciences
- Cultural Studies
- Engineering
- General Interest
- Geosciences
- Industrial Chemistry
- Islamic and Middle Eastern Studies
- Jewish Studies
- Library and Information Science, Book Studies
- Life Sciences
- Linguistics and Semiotics
- Literary Studies
- Materials Sciences
- Mathematics
- Social Sciences
- Sports and Recreation
- Theology and Religion
- Publish your article
- The role of authors
- Promoting your article
- Abstracting & indexing
- Publishing Ethics
- Why publish with De Gruyter
- How to publish with De Gruyter
- Our book series
- Our subject areas
- Your digital product at De Gruyter
- Contribute to our reference works
- Product information
- Tools & resources
- Product Information
- Promotional Materials
- Orders and Inquiries
- FAQ for Library Suppliers and Book Sellers
- Repository Policy
- Free access policy
- Open Access agreements
- Database portals
- For Authors
- Customer service
- People + Culture
- Journal Management
- How to join us
- Working at De Gruyter
- Mission & Vision
- De Gruyter Foundation
- De Gruyter Ebound
- Our Responsibility
- Partner publishers

Your purchase has been completed. Your documents are now available to view.
“Approaching Abjection,” from Powers of Horror: An Essay on Abjection
From the book classic readings on monster theory.
- Julia Kristeva
- X / Twitter
Supplementary Materials
Please login or register with De Gruyter to order this product.
Chapters in this book (15)
Abjektion und existenzielle Krise
Abjection and existential crisis
- Original Article
- Open access
- Published: 26 November 2021
- Volume 2 , pages 73–82, ( 2021 )
Cite this article
You have full access to this open access article

- Tobias Schramm 1
3022 Accesses
1 Altmetric
Explore all metrics
It is thus not lack of cleanliness or health that caused abjection but what disturbs identity, system, order. What does not respect borders, position, rules. The in-between, the ambiguous, the composite (Kristeva 1982 , p. 4).
Zusammenfassung
Julia Kristevas Konzept der Abjektion, das sie in ihrer Monografie Powers of Horror. An Essay on Abjection (1982) vorstellt, wird in der Rezeption nicht selten mit Prozessen des Ausschlusses und der Exklusion gleichgesetzt – sei es auf innerpsychischer oder sozialer Ebene. Das ist zunächst nicht verwunderlich, spielt doch die Grenze und Grenzziehung in ihrem Werk eine entscheidende Rolle: Die Abjektion ist die Grundlage der Konstitution des Subjektes und damit auch der kulturellen Ordnung, die Subjekte hervorbringt. Nur durch die Grenzziehung, als Produkt der Abjektion, können Subjekte eine stabile Psyche und eine kulturelle Identität überhaupt erst entwickeln.
Diese Lesart verkennt jedoch die grundlegende theoretische Anlage des Konzeptes bzw. wendet den Begriff bereits auf psychische, aber auch soziale Prozesse an, für welche die Abjektion zunächst erst einmal die Grundlage bildet: Bei der Abjektion, so meine Lesart des Begriffs, handelt es sich primär um die Herstellung einer Grenze. Erst die Herstellung einer Grenze bildet schließlich die Grundlage für Prozesse des Ausschlusses, und zwar sowohl in der frühkindlichen Subjektbildung als auch in der Etablierung kultureller Grenzziehungen und damit der Konstitution sozialer Ordnung. Das Erleben des Abjekten ist, so argumentiere ich in diesem Beitrag, im Grunde gleichzusetzen mit einer existenziellen Krise: Durch die Irritation ontologischer Grenzen findet sich das Subjekt in einem Zustand existenzieller Angst wieder.
So bieten zahlreiche Ansätze wie etwa Kant, Kierkegaard oder Heidegger in ihren Begriffsinstrumentarien differenzierte Konzepte der ‚existenziellen Angst‘ bzw. einer existenziellen Krise an, die es ermöglichen, den speziellen psychologischen Zustand, den Kristeva mit dem Begriff des Abjekts adressiert, als existenzielle Angst oder Krise (bzw. als existenzielle Ungewissheit) zu verstehen.
The concept of abjection, which was famously introduced by Julia Kristeva in Powers of Horror. An Essay on Abjection (1982), is quite often referred to the phenomena or the process of exclusion—either forms of psychological or social exclusion. This is not very surprising: the concept of boundaries and the process of setting these boundaries play an important role in Powers of Horror. The process of abjection is the foundation for subjectivity and therefore the fundamental basis for culture and the possibility to form cultural identities. Only through abjection and the establishing of fundamental boundaries is it possible to become a subject—as well as a subject of a certain cultural system. But this is not the way I want to read Kristeva, as it misunderstands the theoretical groundworks of the concepts of abject and abjection. This way of understanding the concept of abjection identifies the process of exclusion as abjection. I want to argue that abjection is not to be identified as exclusion but rather to be understood as a precondition of exclusion. And I want to clear out a second misconception of Kristevas’ work: that the concept of abject is not to be understood as an object. Instead, abject is rather to be referred to as a state of mind, best explained in ways of Kants’ or Kierkegaards’ and Heideggers’ (1979 [1927], 2006 [1929]) concept of existential fear.
Avoid common mistakes on your manuscript.
1 Einleitung: Grenzziehungen
Julia Kristevas Konzept der Abjektion, das sie in ihrer Monografie Powers of Horror. An Essay on Abjection ( 1982 ) vorstellt, wird in der Rezeption nicht selten mit Prozessen des Ausschlusses und der Exklusion gleichgesetzt – sei es auf innerpsychischer oder sozialer Ebene (vgl. dazu Butler 1993 oder Arya 2014 ). Das ist zunächst nicht verwunderlich, spielt doch die Grenze und Grenzziehung in ihrem Werk eine entscheidende Rolle: Die Abjektion ist die Grundlage der Konstitution des Subjektes und damit auch der kulturellen Ordnung, die Subjekte hervorbringt. Nur durch die Grenzziehung, als Produkt der Abjektion, können Subjekte eine stabile Psyche und eine kulturelle Identität überhaupt erst entwickeln.
Diese Lesart verkennt jedoch die grundlegende theoretische Anlage des Konzeptes bzw. wendet den Begriff bereits auf psychische, aber auch soziale Prozesse an, für welche die Abjektion zunächst erst einmal die Grundlage bildet Footnote 1 : Bei der Abjektion, so meine Lesart des Begriffs, handelt es sich primär um die Herstellung einer Grenze. Erst die Herstellung einer Grenze bildet schließlich die Grundlage für Prozesse des Ausschlusses, und zwar sowohl in der frühkindlichen Subjektbildung als auch in der Etablierung kultureller Grenzziehungen und damit der Konstitution sozialer Ordnung. Das Erleben des Abjekten ist, so argumentiere ich in diesem Beitrag, im Grunde gleichzusetzen mit einer existenziellen Krise: Durch die Irritation ontologischer Grenzen findet sich das Subjekt in einem Zustand existenzieller Angst wieder. Und die existenzielle Krise des Subjekts muss durch Abjektion, der (Wieder‑)Herstellung dieser Grenzen, behoben werden.
Ich möchte insofern den Begriff der existenziellen Krise als Ausgangspunkt dafür nutzen, um die Begriffe der Abjektion und des Abjekten verständlich und die Theorie Kristevas philosophisch anschlussfähig zu machen – auch abseits einer psychoanalytischen oder sozialwissenschaftlichen Rezeption hinaus. So bieten zahlreiche Ansätze wie etwa Kant ( 1786 ), Kierkegaard ( 1992 ) oder Heidegger ( 1979 [1927], 2006 [1929]) in ihren Begriffsinstrumentarien differenzierte Konzepte der ‚existenziellen Angst‘ bzw. einer existenziellen Krise an, die es ermöglichen, den speziellen psychologischen Zustand, den Kristeva mit dem Begriff des Abjekts adressiert, als existenzielle Angst oder Krise (bzw. als existenzielle Ungewissheit) zu verstehen.
Im Folgenden werde ich daher zunächst in das Konzept der existenziellen Krise einführen und besonders auf das auch für neuere Ansätze grundlegende Konzept der Ungewissheit eingehen, das bereits bei Immanuel Kant angelegt ist. Die Überwindung dieser Krise, so Kant, beruht basal auf der Fähigkeit, eine reflexive Distanz zum eigenen Begehren aufzubauen und eine Grenze, die durch die Vernunft bestimmt wird, einzuführen. Mithilfe des Begriffs der existenziellen Krise will ich zeigen, dass Abjektion als Herstellung von der eigenen Subjektivität in einem metaphysisch-psychologischen Sinn handelt – nämlich der Herstellung ontologischer Grenzen des Subjekts.
Die Abjektion ist damit nicht der Prozess des Ausschlusses, sondern wird als Herstellung einer Grenze verstehbar, die einen Ausschluss erst möglich macht. Und das Abjekt ist damit nicht als empirisches Objekt, welches ausgeschlossen wird, sondern als Zustand der Ungewissheit zu verstehen. Footnote 2 Abschließend wird dafür plädiert, auch umgekehrt den analytischen Mehrwert der Theorie Kristevas für die Soziologie und Philosophie nutzbar zu machen: Und damit sind insbesondere Theorien gemeint, die Begriffe der Ungewissheit (oder Gewissheit) und Selbstschöpfung bearbeiten.
2 Existenzielle Ungewissheit, oder: Die Vertreibung aus dem Paradies
In seinem Aufsatz mit dem Titel Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte stellt Kant ( 1786 ) den Menschen, als, wie es die philosophische Anthropologie – so beispielsweise Plessner oder Gehlen – (vgl. Fischer 2016 ) beschreiben würde, in die existenzielle Ungewissheit eines instinktreduzierten und weltoffenen Wesens geworfen vor. Das Beispiel, das Kant hierfür wählt, ist in keinerlei Hinsicht trivial und dazu metaphysisch stark aufgeladen: der Sündenfall als Urszene der menschlichen Subjektwerdung.
Der Mensch im Garten Eden ist, so interpretiert es Kant ( 1786 , S. 111), zunächst allein von seinen Instinkten geleitet. Diese geben dem Menschen alle notwendigen Regeln für das Leben im Paradies vor. Durch seinen Instinkt erhält der Mensch ein erstes normatives Prinzip: Er bestimmt, wie er sich in welchen Situationen verhält, was er begehrt und was er fürchtet und was er isst. Aber zur ersten normativen Ausstattung des Menschen gehört nicht nur der Instinkt, sondern auch die Vernunft. Und so stellt der Mensch mittels seiner Vernunft auch Überlegungen über die Objekte seiner Ernährung an und damit auch über die Objekte, die zur Befriedigung seiner Bedürfnisse geeignet sind. Kant spekuliert darüber, dass einerseits der Apfel mit einer Birne verglichen worden sei – „Birnen schmecken gut, der Apfel sieht aus wie eine Birne, also sollten wir doch mal den Apfel probieren“. Oder aber: „Die Schlange ist ein Lebewesen wie wir, und sie isst den Apfel; also sollten wir doch mal den Apfel probieren“ (vgl. dazu Korsgaard 2009 , S. 117–118). Der Vergleich führt dazu, dass der Mensch zum ersten Mal vor einer Entscheidung steht:
[S]o konnte dieses schon der Vernunft die erste Veranlassung geben, mit der Stimme der Natur zu chikaniren (III, 1) und trotz ihrem Widerspruch, den ersten Versuch von einer freien Wahl zu machen, der als der erste wahrscheinlicherweise nicht der Erwartung gemäß ausfiel (Kant 1786 , S. 112).
Im Zuge der ersten Entscheidung setzt sich der Mensch durch den Vergleich ein eigenes normatives Prinzip: ich sollte den Apfel essen, um meinen Hunger zu stillen. Die Entscheidung, dieser Maxime nachzugehen, wird die erste Instanz der Willensfreiheit des Menschen. Er erkennt sich von seinen natürlichen Trieben geleitet. Aber durch den Vergleich und die Tätigkeit der Vernunft eröffnet er sich selbst die Möglichkeit, ein Objekt, das nicht von seinen Instinkten bestimmt wird, auszuwählen, um seinen Hunger zu stillen. In der konkreten Auswahl des Objekts, des Apfels folgt er nicht seinem Instinkt, sondern seiner Fähigkeit, vernünftig zu sein und Entscheidungen zu treffen:
Aus dieser Darstellung der ersten Menschengeschichte ergibt sich: da der Ausgang des Menschen aus dem ihm durch die Vernunft, als erster Aufenthalt seiner Gattung vorgestellten Paradieses nicht anders, als der Übergang aus der Rohigkeit eines bloß thierischen Geschöpfes in die Menschheit, aus dem Gängelwagen des Instinkts zur Leitung der Vernunft, mit einem Worte, aus der Vormundschaft der Natur in den Stand der Freiheit gewesen sei (Kant 1786 , S. 115).
Indem er sich selbst normative Prinzipien gibt, die sein Handeln bestimmen, macht sich der Mensch, so Kant, zum Urheber seiner selbst. Er „befreit“ sich in der ersten freien Entscheidung (die übrigens Eva zugeschrieben werden kann) von der Handlungsdetermination durch seine Instinkte. Das heißt aber nicht, dass Instinkte nicht mehr weiter wirksam sind (vgl. dazu Kant 1786 , S. 112–115), doch schafft, so Kant, das menschliche Bewusstsein die Bedingungen der Möglichkeit einer kritischen Distanz zu den Instinkten und damit einen Raum, in dem diese Instinkte bewusst werden können. Der Mensch steht zu sich selbst also in einer bestimmten Art von reflexiver Distanz (vgl. dazu Kant 1786 , Frankfurt 2001 ; Korsgaard 2009 ). Diese reflexive Distanz ermöglicht es ihm, sich eigene Handlungsprinzipien zu geben, und sich von seinen Trieben zu distanzieren: „Wo Es war, soll Ich werden“ (Freud 1933 , S. 86).
Qua der Distanz durch sein Bewusstsein wird es dem menschlichen Subjekt möglich, nicht mehr rein durch die biologischen Instinkte bestimmt zu sein – nicht dadurch, dass alle biologischen Anreize und Instinkte aus seinem Wesen getilgt werden. Dies wäre auch nicht möglich. Aber das menschliche Subjekt kann bestimmen, wann und wie es seinen Trieben und Begierden folgen soll.
Aber mit der Lösung von den Instinkten geht nach Kant auch ein großer Verlust einher. Der Mensch verliert die durch Instinkte wohlstrukturierte Welt, in der die Bedeutung der Objekte, also was sie sind und welchen Zweck sie haben, vorgegeben war. Ohne diese Instinkte ist der Mensch in ein ununterschiedenes Chaos geworfen. Er ist mit Ungewissheit konfrontiert und erfährt eine existenzielle Krise:
Er entdeckte in sich ein Vermögen, sich selbst eine Lebensweise auszuwählen, und nicht gleich anderen Thieren an eine einzige gebunden zu sein. Auf das augenblickliche Wohlgefallen, das ihm dieser bemerkte Vorzug erwecken mochte, mußte doch sofort Angst und Bangigkeit folgen: wie er, der noch kein Ding nach seinen verborgenen Eigenschaften und entfernten Wirkungen kannte, mit seinem neu entdeckten Vermögen zu Werke gehen sollte. Er stand gleichsam am Rande eines Abgrundes; denn aus einzelnen Gegenständen seiner Begierde, die ihm bisher der Instinct angewiesen hatte, war ihm eine Unendlichkeit derselben eröffnet, in deren Wahl er sich noch gar nicht zu finden wußte (Kant 1786 , S. 112).
Die Fähigkeit, eine eigene Lebensweise auszuwählen (der Sündenfall) geht damit mit dem Erwachen unserer Vernunft und damit mit dem Ausschluss aus dem Paradies einher. Der Mensch muss also nicht nur seine eigene Subjektivität, sondern auch die Welt, in der er lebt, selbst schöpfen. Er ist jedoch zunächst gezwungen, sich mit der Ungewissheit und Angst auseinanderzusetzen, was er tun soll, was er selbst ist und was die Dinge der Welt für ihn bedeuten und welchen Zweck sie haben sollen. Und Kant ist der erste Philosoph, der explizit diese existenzielle Angst und Ungewissheit thematisiert (ihm folgen dann aber in der Problematisierung dieser existenziellen Angst unter anderem Kierkegaard und Heidegger) Footnote 3 . Der Ausschluss aus dem Paradies ist damit nicht nur eine Geschichte der Willensfreiheit und der Geburt des selbstbestimmten und vernunftbegabten Menschen. Es ist auch die Geschichte eines Abgrundes, eine Geschichte von existenzieller Angst und Schrecken. Und es ist diese existenzielle Krise der Ungewissheit, in welcher sich der psychische Zustand des Abjekten verorten lässt.
3 Die Schrecken und Möglichkeiten der Ungewissheit: Abjekt und Abjektion
Durch die Herstellung einer Grenze konstituieren wir uns, nach Kristeva, als Subjekt – und damit auch als kulturelles Subjekt, da bestimmte Grenzziehungen nur in einem bestimmten kulturellen Rahmen geboten sind. Die Grenzziehung ist Teil unserer ontologischen Realität – einmal, um uns generell als Subjekt etablieren und verstehen zu können und andererseits, um uns immer wieder der Gewissheit einer bestimmten kulturellen Existenz zu versichern. Wir vergewissern uns unserer individuellen, aber auch sozialen und kulturellen Identität: „There, abject and abjection are my safeguards. The primers of my culture“ (Kristeva 1982 , S. 2). Die Abjektion, die auf die Irritation einer Grenze reagiert, konstituiert und sichert somit nicht nur grundlegende kulturelle Normen, sondern auch unsere Möglichkeit, sich innerhalb der Welt zurechtfinden zu können. Sie sichert unseren Standpunkt in der Welt (Kristeva 1982 ; Taylor 1996 ).
3.1 Abjekt als Zustand der Ungewissheit
Ähnlich wie Kant den Zustand des in die Welt geworfenen Subjekts als einen durch „Angst und Bangigkeit“ bestimmten Zustand „am Rande eines Abgrundes“ (Kant 1786 , S. 112) bestimmt, beschreibt Julia Kristeva das Abjekt in Powers of Horror als die Erfahrung der „emptiness“ (Kristeva 1982 , S. 6) als das Gefühl: „nothing is familiar, not even the shadow of a memory“ (Kristeva 1982 , S. 6).
Abjekt ist also nicht, wie es oft verstanden wird, ein bestimmtes Objekt, das etwa mit Ekel besetzt ist (siehe dazu bspw. Menninghaus 1999 ) und von dem sich das Subjekt radikal abwenden muss, sondern die existenzielle Bedrohung des Subjekts und seiner Welt durch die Auflösung ontologischer Sicherheiten (also epistemischer Grenzen). Es ist stattdessen die Auflösung aller Prinzipien, sich in der Welt zu orientieren: Ein Objekt ist immer nur ein Objekt, weil es bestimmte Kriterien gibt, es zu bestimmen und sich ihm gegenüber zu verhalten. Ein Subjekt ist nur Subjekt, wenn es Kriterien hat, die Entscheidungen und Handlungen ermöglichen: also Handlungsprinzipien im kantischen Sinne (Kant 1986 ):
Wenn wir in Gedanken alle Begrenzungen aufheben, so bleibt nicht ein Wille übrig, der kraft seiner Unbegrenztheit besonders große Freiheit besitzt. Was übrig bleibt, ist, weil es kein bestimmter Wille mehr ist, überhaupt kein Wille mehr (Bieri 2007 , S. 240).
Der Begriff des Abjekts bezeichnet genau diese Abwesenheit von Kriterien und die Ungewissheit und existenzielle Angst und damit Krise eines menschlichen Subjekts. Gleichzeitig ist die Abjektion der erste Moment einer Entscheidung, also des Setzens von Grenzen und Kategorien. Doch zunächst fehlen diese Grenzen und das Abjekt ist nichts, worauf wir Bezug nehmen können: „When I am beset by abjection, the twisted braid of affects and thoughts I call by such a name does not have, properly speaking, a definable object “ (Kristeva 1982 , S. 1; Herv. i. Orig.). Abjekt ist kein empirisches Objekt, sondern das Fehlen einer Ordnung, die Abwesenheit klarer Grenzen und die Unfähigkeit des Subjekts, eine klare Grenzziehung vorzunehmen: „The abject has only one quality of the object – that of beeing opposed to I “ (Kristeva 1982 , S. 1; Herv. i. Orig.). Stattdessen besteht der Zustand des Abjekten allein in der Ungewissheit. Er zeigt sich in der Angst und dem Schrecken der Unsicherheit, nicht unterscheiden zu können, was Teil von uns und was nicht mehr Teil von uns selbst ist. Insofern ist es eine phänomenologische Erscheinung bzw. die Form fehlender Differenzierung. Der Zustand des Abjekten schafft insofern einen Raum, in dem Bedeutungen aufhören zu existieren: „[W]hat is abject, […] draws me toward the place where meaning collapses“ (Kristeva 1982 , S. 2). Grenzen werden nicht einfach nur überschritten, sondern gänzlich aufgelöst. Der Zustand des Abjekten zeigt sich nur in der Abwesenheit bzw. Ungewissheit einer klaren Grenze – in der Unmöglichkeit Subjekt und Objekt, Innen und Außen, Eigenes und Fremdes zu trennen.
Und damit können wir eine entscheidende Analogie zu Kants mutmaßlichem Beginn der Menschheit ziehen. Wie zuvor dargelegt, ist es die Fähigkeit zur Willensfreiheit, die Fähigkeit des Menschen, eine reflexive Distanz zu seinen Begierden einzunehmen, welche die naturgegebene Ordnung der Welt für das Subjekt auflöst. Kristeva beschreibt ebenfalls einen solchen Verlust der Struktur der Welt durch das Abjekt und damit die Aufgabe, sich selbst zu schöpfen: „[A]ll its objects [die Objekte des Subjekts, Anm. d. Autors] are based merely on the inaugural loss that laid the foundations of its own“ (Kristeva 1982 , S. 5, Herv. i. Orig.). Der Mensch ist in dieser Hinsicht nicht nur zu Freiheit verdammt, sondern auch dazu, seine Welt sinnhaft zu strukturieren. Die reflexive Distanz des Menschen, die ihn aus der Welt der Instinkte herauswirft und damit vor die Aufgabe stellt, eine Welt und die Objekte dieser Welt selbst zu bestimmen, ist die Geburt des Zustands des Abjekten. Abjekt, bzw. der phänomenologische Zustand der Ungewissheit – die Schnittstelle zwischen Unordnung der Welt und Willensfreiheit – ist ein Zustand, der das Subjekt zwingt, sich selbst zu schöpfen, indem es eine Grenze, eine Unterscheidung etabliert. Und genau diesen Vorgang der Selbstgesetzgebung beschreibt Kristeva mit der Abjektion und damit mit der Einführung einer Grenze.
3.2 Abjektion und die menschliche (Selbst‑)Schöpfung
Um das Phänomen der Abjektion besser verstehen zu können, muss man sich das Subjekt und dessen Identität als Prozess vorstellen. Das Subjekt bzw. das „Ich“ ist kein festes bzw. festgelegtes Wesen und keine abgetrennte, unbeeinflussbare Entität, sondern immer abhängig von der Abgrenzung von anderen Objekten und Subjekten (Hegel 1986 ). Das Gefühl der eigenen Subjektivität und des eigenen „Ichs“ wird insofern durch die Abgrenzung bzw. Abtrennung von Objekten und durch die Positionierung in einem sozialen Raum mit und durch andere Subjekte überhaupt erst hergestellt (vgl. dazu Taylor 1983 , 1996 ). Subjektivität ist das Produkt eines Prozesses von Grenzziehungen und der Übernahme von Grenzen und Unterscheidungen, die bereits durch eine soziale oder kulturelle Ordnung hergestellt worden sind.
Was genau das Subjekt gegen die Bedrohung der Auflösung oder Überschreitung individueller und sozialer Grenzen bewahrt, adressiert Kristeva mit dem Konzept der Abjektion.
Die Abjektion ist damit die Antwort – entweder des psychischen Subjekts oder des sozialen Subjekts – auf die Bedrohung oder Auflösung einer Grenze; dass beispielsweise der Körper nicht einfach nur „menschlich“, sondern auch animalisch sein kann. Der kreatürliche Teil des menschlichen Selbst stellt insofern ständig das individuelle und soziale Selbstverständnis und die kulturellen Grenzziehungen in Frage. Die Folge ist, dass Subjekte versuchen müssen, diejenigen Objekte, die eine Irritation oder Auflösung der Grenzen hervorrufen, aus ihrer Welt auszuschließen.
In Kants Urszene der existenziellen Krise haben wir gesehen, dass der Mensch durch sein Bewusstsein und seine Vernunft dazu in der Lage ist, seine natürlichen Begierden zu hinterfragen. Diese Analogie kann genutzt werden, um zu verstehen, warum für Kristeva das Abjekt insbesondere in der Konfrontation des Menschen mit seiner auch schwer zu kontrollierenden Kreatürlichkeit hervortritt: Zwar können sich Subjekte von ihren Instinkten distanzieren, aber sie sind dennoch immer Teil des eigenen Selbst. Sie werden sie nie endgültig überwinden können und sind stetig vor die Aufgabe gestellt, zu entscheiden, inwiefern sie ihren Instinkten Macht über sich selbst zugestehen. Als Wesen, das dazu fähig ist, sich selbst zu schöpfen, ist der Mensch ständig zerrissen. Das Abjekt findet sich aber nicht in der ständigen Erinnerung an unsere Kreatürlichkeit wieder. Stattdessen wird der Zustand des Abjekten in der Zerrissenheit des Subjekts geboren; im ständigen Widerstreit zwischen seinen Begierden und seiner Vernunft. Footnote 4
Das Subjekt ist damit gezwungen, diese Zerrissenheit zu überwinden und sich selbst zu einer psychischen Einheit (vgl. dazu Kristeva 1982 ; Korsgaard 2009 ; Castoriadis 2012 ) wieder zusammenzufügen. Grundsätzlich kann damit der Prozess der Abjektion als die Herstellung von Subjektivität überhaupt verstanden werden, indem er die Einführung der primären existenziellen Grenze repräsentiert. Mit dieser Schöpfung wird erst dasjenige produziert, was sich innerhalb oder außerhalb dieser Grenzen verortet. Diese grundlegende Unterscheidung muss ihren Ursprung selbst aber nicht zwingend in einem Individuum haben. Ganz im Gegenteil: Mit Kristeva lässt sich beschreiben, dass es nur eine grundlegend psychobiologische Grenzziehung gibt – und das ist die Grenzziehung zwischen dem Selbst und dem Objekt (vgl. dazu Kristeva 1982 ). Alle anderen Grenzziehungen oder basale Unterscheidungen sind immer mit einer bestimmten kulturellen Logik oder Sprache verbunden, einem bestimmten symbolischen Raum – einer Kultur, Weltanschauung, Religion oder Lebensform.
Der Zustand des Abjekten bzw. die existenzielle Ungewissheit taucht insofern nur in der Irritation der Grenze auf, und diese Irritation spüren Subjekte nur, weil sie subjektiv oder kulturell noch keine klare oder eindeutige Möglichkeit gefunden haben, mit der Irritation umzugehen. Der Irritation der Grenzziehungen begegnen Subjekte in der Etablierung von Praktiken, die ständig reproduziert (aber auch verändert und angepasst) werden müssen, um diese wieder re-etablieren zu können. Subjekte und soziale Gemeinschaften sind also insofern vor die Aufgabe gestellt, die Abjektion immer wieder zu meistern oder neu zu entwerfen und auch dem Zustand der Ungewissheit, der existenziellen Angst und damit der existenziellen Krise mit neuen Formen bzw. Praktiken der Abjektion zu begegnen. Das Individuum, und schließlich auch die Gesellschaft, ist damit nicht nur vor die Aufgabe gestellt, sich immer wieder neu zu schöpfen, sondern kann genuin als menschliche Selbstschöpfung verstanden werden (vgl. dazu auch Castoriadis 1990 ).
4 Der Preis der Freiheit: Ungewissheit und existenzielle Angst
Im Verlust der Tatsache, sich nicht mehr nur auf seine Instinkte verlassen zu können, erfährt der Mensch, so Kant, einen Bruch. Er steht vor der Aufgabe, sich selbst zu schöpfen und findet sich in einem Zustand der Ungewissheit wieder: einer existenziellen Krise. Im Zustand der existenziellen Krise und der Angst, die damit einhergeht, verorte ich den Begriff des Abjekten.
Zerrissen – zwischen seiner Natürlichkeit und seiner Fähigkeit zur Vernunft – steht das Subjekt vor der Aufgabe, sich wieder zusammenzusetzen. Und dies wird durch die Abjektion geleistet: Wir setzen uns im Handeln, in einem normativen Prinzip, in einer Grenzziehung wieder zusammen. Wir erschaffen uns selbst, in dem wir einen Willen, ein Handlungsprinzip im kantischen Sinne hervorbringen und uns mit diesem Willen identifizieren.
Der Begriff der Abjektion kann insofern an Kierkegaards ( 1992 ) und Heideggers ( 1979 [1927], 2006 [1929]) Philosophie der existenziellen Angst und der philosophischen Anthropologie Plessners und Gehlens (Fischer 2016 ) anschlussfähig gemacht werden und bietet damit eine psychoanalytische Ergänzung und Vervollständigung des Verständnisses einer grundlegenden Notwendigkeit des menschlichen Subjekts: sich selbst als ein, in der Zerrissenheit zwischen seiner Natürlichkeit und Vernunft lebendes Wesen, als Subjekt zu setzen.
Kristevas Begriffe des Abjekten und der Abjektion können aber nicht nur die Existenzphilosophie, sondern auch die soziologische Theoriebildung bereichern und jene Momente im Dasein von (kulturellen) Subjekten bestimmen und verständlich machen, die eine existenzielle Krise erfahren. Der Begriff der Abjektion bietet damit nicht nur die Möglichkeit, den Zustand kultureller Subjekte zu erfassen, sondern auch die Möglichkeit, den Umgang sozialer Subjekte zu beschreiben, die mit Phänomenen der Indifferenz oder Ambivalenz (Giesen 2011 ) konfrontiert sind. Und: der Begriff des Abjekten und der Abjektion kann für eine soziologische Theorie der Imagination bzw. des Imaginären und der Schöpfung von sozialem Sinn (Castoriadis 1990 ; vgl. Pfaller 2021 ) fruchtbar gemacht werden, welche zu erklären versucht, wie existenzielle soziale Krisen oder soziale Ungewissheiten von Subjekten bearbeitet werden – durch die Schöpfung einer sinnhaften Welt.
So wird nicht selten Judith Butlers Verwendungsweise des Begriffs der Abjektion herangezogen, wenn ein sozialer oder kultureller Ausschluss erklärt werden soll (vgl. dazu Butler 1993 ). Und dies obwohl Butlers Verwendungsweise der Begriffe des Abjekt und der Abjektion von Kristeva deutlich abweicht.
Im Sinne von Wittgensteins’ Auffassung von Gewissheit (vgl. dazu Wittgenstein 1984 ).
So beschreibt beispielsweise Kierkegaard ( 1992 ) in Der Begriff Angst die erste freie Entscheidung – die erste freiheitliche Selbstsetzung bzw. die Setzung des ersten normativen Prinzips im menschlichen Sündenfall – im Anschluss an Kant als fehlgeleitete Selbstsetzung.
An dieser Stelle wird auch verständlich, warum wir uns nach Kristeva von „abjekten“ Dingen (also Dingen, die unseren Subjektstatus in Frage stellen) angezogen fühlen. Das Abjekt tritt uns eben nicht als ein konkretes Objekt gegenüber, sondern ist Ambivalenz oder Ungewissheit. Wir finden uns, weil der Zustand des Abjekt sich eben in der Gegenüberstellung von unserer Natürlichkeit und Vernunft verortet, in den „abjekten“ Dingen wieder, die wir schließlich aus Ekel von uns entfernen wollen. Dass wir von bestimmten Dingen gleichzeitig abgestoßen und angezogen werden, ist kein Widerspruch. Stattdessen ist es Ausdruck der Frage, wer wir sind: Wir können uns in der Abstoßung und in der Anziehung wiederfinden.
Arya, Rina. 2014. Abjection and Representation . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Book Google Scholar
Bieri, Peter. 2007. Das Handwerk der Freiheit . Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Google Scholar
Butler, Judith. 1993. Bodies that matter . New York/London: Routledge.
Castoriadis, Cornelius. 1990. Gesellschaft als imaginäre Institution . Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Castoriadis, Cornelius. 2012. Von der Monade zur Autonomie. In: Psychische Monade und Autonomes Subjekt . Hrsg. Michael Halfbrodt, Harald Wolf, Bd. 5, 47–76. Lich: Verlag Edition.
Fischer, Joachim. 2016. Philosophische Anthropologie: Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts. Freiburg: Karl Alber Verlag.
Frankfurt, Harry. G. 2001. Willensfreiheit und der Begriff der Person. In Harry G. Frankfurt: Freiheit und Selbstbestimmung , Hrsg. Monika Betzler, Barbara Guckes, 65–83. Berlin: Akademie Verlag.
Chapter Google Scholar
Freud, Sigmund. 1933. Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse . Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
Giesen, Bernhard. 2011. Zwischenlagen. Das Außerordentliche als Grund der sozialen Wirklichkeit. Weilerswist . Verlag: Velbrück.
Hegel, G.W.F. 1986. Wissenschaft der Logik , Bd. I. Werkausgabe, Bd. V. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Heidegger, Martin 1979 [1927]. Sein und Zeit . Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
Heidegger, Martin. 2006 [1929]. Was ist Metaphysik? Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann.
Kant, Immanuel. 1986. Kritik der praktischen Vernunft . Stuttgart: Reclam.
Kant, Immanuel. 1786. Band VIII: Abhandlungen nach 1781. In Mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte. Gesammelte Schriften , Hrsg. Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 107–125. 1902.
Kierkegaard, Sören. 1992. Der Begriff Angst . Stuttgart: Reclam.
Korsgaard, Christin M. 2009. Self-Constitution . Oxford: Oxford University Press.
Kristeva, Julia. 1982. Powers of Horror . New York: Columbia University Press.
Menninghaus, Winfried. 1999. Ekel: Theorie und Geschichte einer starken Empfindung . Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Pfaller, Larissa. 2021. Die dunkle Seite der Vorstellungskraft: Das Abjekt als Verworfenes im Imaginären. Österreichische Zeitschrift für Soziologie 46:301–319.
Article Google Scholar
Taylor, Charles. 1983. Hegel . Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Taylor, Charles. 1996. Quellen des Selbst . Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Wittgenstein, Ludwig. 1984. Bemerkungen über die Farben, Über Gewißheit, Zettel, Vermischte Bemerkungen . Werkausgabe, Bd. VIII. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Download references
Der vorliegende Artikel ist entstanden im Rahmen des von der DFG geförderten Projekts „Das Imaginäre an den Grenzen des Sozialen“ (Projektnummer: 417783052).
Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.
Author information
Authors and affiliations.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland
Tobias Schramm
You can also search for this author in PubMed Google Scholar
Corresponding author
Correspondence to Tobias Schramm .
Rights and permissions
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de .
Reprints and permissions
About this article
Schramm, T. Abjektion und existenzielle Krise. cult.psych. 2 , 73–82 (2021). https://doi.org/10.1007/s43638-021-00025-9
Download citation
Received : 01 June 2021
Accepted : 27 October 2021
Published : 26 November 2021
Issue Date : June 2021
DOI : https://doi.org/10.1007/s43638-021-00025-9
Share this article
Anyone you share the following link with will be able to read this content:
Sorry, a shareable link is not currently available for this article.
Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative
Schlüsselwörter
- Grenzziehungen
- Krise des Subjekts
- Ungewissheit
- Existenzielle Angst
- Crisis of the subject
- Uncertainty
- Existential fear
Advertisement
- Find a journal
- Publish with us
- Track your research

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
Powers of Horror: An Essay on Abjection (French: Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection) is a 1980 book by Julia Kristeva.The work is an extensive treatise on the subject of abjection, in which Kristeva draws on the theories of Sigmund Freud and Jacques Lacan to examine horror, marginalization, castration, the phallic signifier, the "I/Not I" dichotomy, the Oedipal complex, exile, and ...
Abject. It is something rejected from which one does not part, from which one does not protect oneself as from an object. Imaginary uncanniness and real threat, it beckons to us and ends up engulfing us. It is thus not lack of cleanliness or health that causes abjection but what disturbs identity, system, order.
Powers of horror : an essay on abjection ... Powers of horror : an essay on abjection by Kristeva, Julia, 1941-Publication date 1982 Topics Céline, Louis-Ferdinand, 1894-1961, Horror in literature, Abjection in literature Publisher New York : Columbia University Press Collection
This study guide contains the following sections: This detailed literature summary also contains Topics for Discussion and a Free Quiz on Powers of Horror: An Essay on Abjection by Julia Kristeva. Kristeva examines the notion of abjection—the repressed and literally unspeakable forces that linger inside a person's psyche—and traces the role ...
4.06. 3,653 ratings151 reviews. "Kristeva is one of the leading voices in contemporary French criticism, on a par with such names as Genette, Foucault, Greimas and others. . . Powers of Horror is an excellent introduction to an aspect of contemporary French literature which has been allowed to become somewhat neglected in the current emphasis ...
TRANSLATED BY. Leon S. Roudiez. There looms, within abjection, one of those violent, dark revolts of being, directed against a threat that seems to emanate from an exorbitant outside or inside, ejected beyond the scope of the possible, the tolerable, the thinkable. It lies there, quite close, but it cannot be assimilated.
In Powers of Horror, Julia Kristeva offers an extensive and profound consideration of the nature of abjection.Drawing on Freud and Lacan, she analyzes the nature of attitudes toward repulsive subjects and examines the function of these topics in the writings of Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust, James Joyce, and other authors.
Contents Translator's Note vii I. Approaching Abjection i 2. Something To Be Scared Of 32 3-From Filth to Defilement 56 4-Semiotics of Biblical Abomination 90 5-. . .Qui Tollis Peccata Mundi 113 6. Celine: Neither Actor nor Martyr • 133 7-Suffering and Horror 140 8. Those Females Who Can Wreck the Infinite 157 9-"Ours To Jew or Die" 174 12 In the Beginning and Without End . . . 188
This essay analyzes the implications of the performative aspects of Julia. Powers of Horror by situating this work in the context of similar aspects. previous work. This construction and its relationship to abjection are integral nents of Kristeva's notion of practice and as such are fundamental to her. Hegel and Freud.
Powers of Horror: An Essay on Abjection Julia Kristeva No preview available - 2023. Bibliographic information. Title: Powers of Horror: An Essay on Abjection: Author: ... Powers of Horror: An Essay on Abjection Julia Kristeva Limited preview - 2024. Pouvoirs de L'horreur (English) Julia Kristeva Limited preview - 1982.
Kristeva's theory of abjection takes shape slowly in the dense prose of Powers of Horror where she uses the Judeo-Christian tradi-tion, and especially Céline, as examples in her psychoanalysis of Western culture. The first section of Powers attempts to give meaning to the term "abjection" and, in so doing, to describe the
In Powers of Horror, Julia Kristeva offers an extensive and profound consideration of the nature of abjection. Drawing on Freud and Lacan, she analyzes the nature of attitudes toward repulsive subjects and examines the function of these topics in the writings of Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust, James Joyce, and other authors. ...
In Powers of Horror, Julia Kristeva offers an extensive and profound consideration of the nature of abjection. Drawing on Freud and Lacan, she analyzes the nature of attitudes toward repulsive subjects and examines the function of these topics in the writings of Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust, James Joyce, and other authors. ...
Powers of Horror: An Essay on Abjection (European Perspectives Series) Paperback - April 15, 1982 . by Julia Kristeva (Author), Leon Roudiez (Translator) 4.7 out of 5 stars 119. Part of: European Perspectives: A Series in Social Thought and Cultural Criticism (102 books)
The human body ejects bodily waste (blood, sweat, urine, feces) in order to protect itself. Once these items are outside of the body, they are abject due to the threat they pose to the "full" or "complete" subject. By forcing Carrie to confront and exist with the abject (the blood), she is also forced to experience abjection.
In Powers of Horror, Julia Kristeva offers an extensive and profound consideration of the nature of abjection. Drawing on Freud and Lacan, she analyzes the nature of attitudes toward repulsive subjects and examines the function of these topics in the writings of Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust, James Joyce, and other authors. ...
Julia Kristeva's Powers of Horror, which theorizes the notion of the 'abject' in a series of blisteringly insightful analyses, is as relevant, as necessary, and as courageous today as it seemed in 1984.--Peter Connor, Barnard College Dazzling.-- "SubStance" From the Publisher
The clinical manifestations of abjection with which Kristeva deals in phobic and borderline conditions evince a subject/object instability as a corollary of the inability to signify the mother. Kristeva thus inscribes as crucial to the symbolic function a maternal metaphor anterior in some sense to the paternal one and emergent when the latter ...
From the book Classic Readings on Monster Theory. "Approaching Abjection," from Powers of Horror: An Essay on Abjection was published in Classic Readings on Monster Theory on page 67.
The Speaking Abject in Kristeva's Powers of Horror. Thea Harrington. Philosophy. Hypatia. 1998. This essay analyzes the implications of the performative aspects of Julia Kristeva's Powers of Horror by situating this work in the context of similar aspects of her previous work. This construction…. Expand. 24.
%PDF-1.5 %âãÏÓ 1 0 obj > endobj 2 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState >>> endobj 3 0 obj >stream hÞŒ'ËnÛ0 E÷üŠYR Oø ¹tZµuêZ D§H‹.œÔ š¶ ` 0ò ...
The concept of abjection, which was famously introduced by Julia Kristeva in Powers of Horror. An Essay on Abjection (1982), is quite often referred to the phenomena or the process of exclusion—either forms of psychological or social exclusion. This is not very surprising: the concept of boundaries and the process of setting these boundaries play an important role in Powers of Horror. The ...
And this is so because, as I have tried to explain earlier the writings of the chosen people have selected a place, in the most determined manner, on that untenable crest of manness seen as symbolic fact—which constitutes abjection." ― Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection